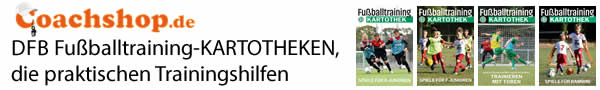Gibt es überhaupt eine geeignete Form der Kommunikation, wenn doch so oft etwas schief geht?
In diesen beiden Beispielen ist es vermutlich nicht die "Kommunikation" per se, die "schief" gelaufen ist (immerhin wurde sie gehört), sondern vermutlich fehlen einfach die Grundlagen dazu: Wahrnehmung, kollektive Spielintelligenz, etc.
Leider ist es auf vielen Plätzen so, dass viele Spieler permanent einen Pass fordern, völlig unabhängig davon ob es Sinn macht oder nicht. DAS ist dann wohl definitiv falsch verstandene "Kommunikation".
Kommunikation ist halt weit mehr als blosses Rufen. Uebungen wie vorher hier von mir beschrieben, können dem entgegenwirken.